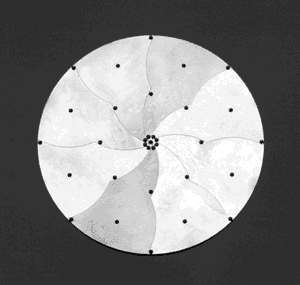photo Kengo Kuma - Breathing Architecture ISBN 978-3-7643-8787-7
photo Kengo Kuma - Breathing Architecture ISBN 978-3-7643-8787-7Im Allgemeinen dient ein japanisches Teehaus als ein Raum, in dem Körper und Geist eins werden können. Um dies wirkungsvoll auszudrücken, wird bewusst der Raum des Teehauses verkleinert. Man sitzt in einem Raum, wo man die Wand ummittelbar vor Augen hat und die Decke so niedrig ist, dass man sich beim Aufstehen fast den Kopf stoßt. Teemeister haben entdeckt, dass auf extrem engem Raum die Sinne geschärft werden und man stärker auf äußere Reize reagiert. In Kombination mit dem Ritual des Teetrinkens, verschwinden so die weltlichen Gedanken und Körper und Geist verschmelzen zu einer Einheit.
 photo Kengo Kuma - Breathing Architecture ISBN 978-3-7643-8787-7
photo Kengo Kuma - Breathing Architecture ISBN 978-3-7643-8787-7Nun zum Teehaus des Museums für Angwandte Kunst in Frankfurt.
Das Teehaus sieht äußerlich sehr futuristisch aus. „In seinem Inneren empfindet man eine schwebend-leichte Weite und ein eigenartiges Gefühl der Schwerelosigkeit und man kann den Sonnenstand und die Veränderungen ihrer Helligkeit wahrnehmen. Bei Dunkelheit gleicht das Teehaus einem überdimensionalen Lichtkörper.
 photo Kengo Kuma - Breathing Architecture ISBN 978-3-7643-8787-7
photo Kengo Kuma - Breathing Architecture ISBN 978-3-7643-8787-7An dem Entwurf dieses Teehauses waren im Großen und Ganzen 2 Bedingungen geknüpft: Das Teehaus sollte auf einem kleinen Hügel neben dem Museum stehen und das Risiko mutwilliger Beschädigung war zu berücksichtigen.
Daraufhin entwickelte Architekt Kengo Kuma im Rahmen des deutsch-japanischen Kulturaustausches und in enger Zusammenarbeit mit formTL, 2 Jahre lang das Teehaus, bevor die erste Installierung im Sommer 2007 innerhalb von nur 20 Minuten stattfinden konnte.
Die Installation kann nämlich jederzeit auf und abgebaut werden. Diese Mobilität des Teehauses erfolgt durch die luftgetragene Konstruktion. Diese wiegt nur 180 Kilogramm und funktioniert sogar ohne Luftschleuse. Dies ist möglich durch eine doppelwandige Membranhülle. Beide Hüllen sind an der Aufstandfläche luftdicht miteinander verschweißt und pro m² Oberfläche 4 bis 5 mal mit dünnen Kunststoffseilen gekoppelt. Die Haut des Teehauses besteht aus halb transparente Tenara Textile, dass durch ein hochfrequent-Schweißgerät mit einander verbunden werden.
 photo Kengo Kuma - Breathing Architecture ISBN 978-3-7643-8787-7
photo Kengo Kuma - Breathing Architecture ISBN 978-3-7643-8787-7 photo Kengo Kuma - Breathing Architecture ISBN 978-3-7643-8787-7
photo Kengo Kuma - Breathing Architecture ISBN 978-3-7643-8787-7Während des Planungs- und Designprozesses mussten viele Hürden überwunden werden. Dazu gehörten auch kulterell bedingte Probleme, wie zum Beispiel die Frage, wie man ein leichtes und vornehmes „weiches“ Gebäude vor Vandalismus schützen kann. Während die japanische Seite eher entspannt war und die Situation vermutlich unterbewertete, wartete die deutsche Seite mit Wort-Case-Szenarien auf.(Sie gipfelte in dem erschreckenden Vorschlag, das Teehaus in ein Stahlhaus einzupacken).
Um auch eine sturmfeste Tragfähigkeit(Windkraft 100 km/h) zu gewährleisten, muss ein kontinuierlicher Luftdruck von 1500 Pascal herrschen, die Konstruktion mit der Fundamentplatte verankert sein und eine Distanz der Membranen in Firsthöhe 1 Meter betragen. Geräuschlosigkeit wird durch einen hochgradig gedämpften mobilen Apparat, der in etwa 20 Meter Entfernung vom Teehaus installiert ist, fast erreicht. Er bläst leise entfeuchtete und warme Luft durch ein unterirdisches Röhren- und Schlauchsystem zur Einblassstutzen am Teehaus.
 photo Kengo Kuma - Breathing Architecture ISBN 978-3-7643-8787-7
photo Kengo Kuma - Breathing Architecture ISBN 978-3-7643-8787-7Maße
Grundfläche 32 m²
Randlänge: 20 m²
Kissenvolumen 35m³
Hauptmaße: 9m (L) x 4,6m (B) x 3,4 (H)
 photo Kengo Kuma - Breathing Architecture ISBN 978-3-7643-8787-7
photo Kengo Kuma - Breathing Architecture ISBN 978-3-7643-8787-7Da das Projekt als Non-Profit-Aktion begann, dauerte es entsprechend, bis sich das Team ein gemeinsames Ziel geschaffen hatte und Struktur, Geld und Arbeitsteilung gefunden wurde. Doch schlussendlich zählte einzig der Geruch und Geschmack einer Tasse Tee!
Ein Youtube-Video ist hier zu finden:
Teehaus aus PlastikDas Buch zum Teehaus besitzt weitere Information zur Geschichte eines Teehauses, Geschichte der Luftarchitektur sowie viele Details des Teehauses von Kengo Kuma.
Größere KartenansichtQuellen: